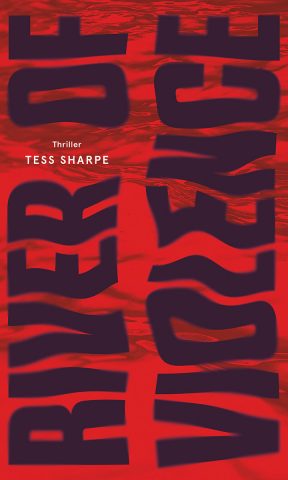Menü
Tess Sharpe, Tochter einer Punkrock-Mutter, geboren in einer Berghütte, wuchs im ländlichen Norden Kaliforniens auf, der Gegend, in der auch ihr Roman spielt. Jetzt lebt sie irgendwo in der tiefsten Provinz mit einem Rudel Hunde und einer stetig wachsenden Kolonie an verwilderten Katzen. „River of Violence“ ist ihr erstes belletristisches Buch.
Synopsis: Harley ist acht, als sie ihrem Vater das erste Mal dabei zusieht, wie er einen Widersacher abknallt. Der Drogenbaron hat mehr Waffen geschmuggelt, mehr Meth gekocht, mehr Männer getötet, als irgendwer anders in der Gegend. Nun, da sie erwachsen ist, arbeitet Harley für ihn, stützt sein System und wird als seine Nachfolgerin gehandelt, obwohl sie den ewigen Kreislauf aus Mord, Leid und Rache hasst und durchbrechen möchte. Gleichzeitig tritt die mächtige Springfield-Familie auf den Plan, Dukes größte Konkurrenz im Drogengeschäft, und inmitten dieses blutigen Revierkampfes muss Harley sich entscheiden: für die Familie, ihren Vater, das System – oder für ihr Leben und ihre Freiheit.
Leseprobe: Ich bin acht, als ich zum ersten Mal erlebe, wie mein Daddy einen Mann umbringt.
Ich soll es natürlich nicht sehen. Aber in den ersten Wochen nach Mommas Tod streune ich wild durch die Gegend, sobald mich Onkel Jake aus den Augen lässt.
Die meiste Zeit verbringe ich im Wald, spiele oben in den Hochsitzen oder probiere aus, wie weit ich auf Bäume hinaufklettern kann, wenn keiner mir hilft. Manchmal weine ich, weil Momma mir so fehlt, ich kann einfach nicht anders. Aber wenn Daddy dabei ist, lasse ich es lieber. Ich mag den Wald. Dort ist es still und laut zugleich. Die Waldgeräusche gehören zu meinem Leben – seit ich denken kann, haben sie mich in den Schlaf gewiegt. Wenn ich auf die großen Eichen klettere, mich mit aller Kraft hochziehe, nach starken Ästen greife und wie ein Eichhörnchen in
den Baumkronen herumturne, muss ich verdammt gut aufpassen, damit ich nicht abrutsche. Dann vergesse ich, dass Momma tot ist. Und dass Daddy nur noch in einer Whiskey-Wolke durch die Gegend stürmt, seine Waffen putzt und über die Springfields flucht. Und dauernd sagt er, dass Blut fließen muss.
Momma ist vor dreieinhalb Wochen gestorben. Seitdem ist die Haut an meinen Handflächen ganz rau geworden vom vielen Klettern. Meine Knie sind voller Schorf, nachdem ich unten beim kleinen Fluss aus dem Redwoodbaum gefallen bin. Brombeeren haben meine Finger blau verfärbt und Dornen meine Arme zerkratzt. Meine Taschen beulen sich von all den Schätzen, die ich im Wald gefunden habe – lauter Sachen, die ihr gefallen hätten: Federn von Blauhähern und flache, geschmeidige Steine, die wunderbar übers Wasser springen würden, eine aufgeplatzte Eichel in der Form eines Gesichts. Ich verstaue diese Waldgeschenke in einem Hochsitz. Onkel Jake will mich zu Mommas Grab mitnehmen, das hat er mir versprochen, obwohl Daddy gleich wieder böse geguckt hat. Ich will ihr unbedingt meine Schätze bringen, Onkel Jake hat nämlich gesagt, sie ist jetzt im Himmel und schaut uns von oben zu.
Manchmal betrachte ich den Himmel und versuche mir das vorzustellen. Und sie zu sehen. Aber da oben sind bloß Äste und Sterne. Daddy merkt gar nicht, wie viel ich weg bin. Er hat anderes im Sinn.
An dem Abend, um den es geht, habe ich lange in die untergehende Sonne geschaut und im Nachthimmel nach Spuren von Momma gesucht. Ich hocke immer noch oben in der Eiche am Rand unseres Gartens – die mit dem langen, starken Ast, auf dem man so gut sitzen kann. Es ist schon spät und ich sollte reingehen, aber da höre ich, wie sich die Reifen eines Pick-ups in den Schotter der unbefestigten Straße graben, die durch den Wald zu unserem Haus führt. Schnell ziehe ich die Füße hoch ins Dunkle, bevor Daddys Chevy um die Kurve kommt und die Scheinwerfer den Garten in helles Licht tauchen.
Ich presse die Fußsohlen gegen den Baumstamm, rutsche auf dem Bauch den Ast entlang nach vorne und recke den Kopf, damit ich besser sehen kann. Kann gut sein, dass er wieder mal betrunken ist. Dann soll er mich besser nicht zu Gesicht kriegen. Ich sehe ihr nämlich so ähnlich und das macht ihn traurig. Manchmal auch wütend, aber dann versucht er, mich das nicht merken zu lassen. Statt wie sonst vor dem Haus anzuhalten, fährt Daddy auf dem Holperweg unter dem Baum durch zur Scheune und hält direkt vor dem Tor. Der Bewegungsmelder reagiert sofort, das Scheunenlicht geht an.
Aus der Entfernung beobachte ich, wie die Scheinwerfer ausgehen und er aus dem Wagen steigt. Immerhin hat er nicht so viel getrunken, dass er taumelt, aber vielleicht hat er seine Sachen trotzdem vollgekotzt, so wie letzte Woche, das kann ich von hier aus nicht erkennen. Ich will schon vom Baum klettern, da sehe ich, dass er nicht zum Haus geht, sondern rüber zur Beifahrertür, die er mit einem Ruck aufzieht.
Ich blinzele durch die Dunkelheit. Jetzt ist er im Schatten und kaum mehr zu sehen, aber er hievt irgendwas Großes aus dem Wagen. Als er das Scheunentor öffnet, tritt er für einen Moment lang ins Licht. Ein Schein fällt auf die Schwelle und kurz kann ich Männerfüße sehen, die über den Scheunenboden gezerrt werden. Dann knallt das Tor zu. Mein Atem geht schnell und hart, drückt meinen Bauch gegen die raue Rinde. Meine Finger krallen sich um den Ast, mein Herz hämmert, alles dreht sich. Ich wünsche mir eine Höhlung im Stamm der Eiche, will mich verstecken wie ein Specht oder ein Eichhörnchen.
Ich versuche mir einzureden, ich hätte mich getäuscht. Aber tief drinnen weiß ich es besser. Ein paar Minuten später – es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, mein Atem und das Grillengezirpe hallen mir in den Ohren – geht das Licht vor dem Scheunentor aus. Finsternis kriecht durch die Bäume, breitet sich überall aus. Ich könnte jetzt runterklettern, in mein Zimmer rennen, die Tür zumachen, mir die Bettdecke über den Kopf ziehen und so tun, als hätte ich nie gesehen, wie diese Füße über den Boden geschleift sind. Aber das tue ich nicht.
Stattdessen klettere ich vom Baum und gehe auf die Scheune zu. Es wäre leicht, im Nachhinein zu behaupten, dass diese Entscheidung ein Fehler war, aber das ist Unsinn. Auf irgendeine Art musste ich es ja erfahren. Was er war. Und was ich werden würde. Das hier ist eben meine Art gewesen.
Ich schleiche also zur Rückseite der Scheune, wo lauter Astlöcher in den Zedernholzbrettern sind. Man sieht kaum etwas durch diese Dinger, aber besser geht es nicht. Ich knie mich hin, sodass ich durch das größte Loch spähen kann, das ich finde. Mein Atem geht immer noch keuchend, das Herz pocht kaninchenschnell in meiner Brust und mein Mund ist trocken.
Zuerst sehe ich Daddy gar nicht. Da ist nur der alte Traktor, der seit Ewigkeiten hier rumsteht, und der Quad, den Daddy letztes Jahr geschrottet hat. An einem Balken hängt eine kahle Glühbirne. Ich beobachte, wie sie an ihrem orangen Kabel ein wenig hin und her schwingt, und auf einmal höre ich sie – seine Stimme. »Du sagst mir jetzt, was ich wissen will«, fordert Daddy. Ich höre ihn rumkramen, anscheinend holt er etwas aus der Werkzeugkiste. Nach ein paar Sekunden taucht er in meinem Blickfeld auf, einen Schraubenzieher in der Hand. Lange Schatten fallen über ihn, während er sich von meinem Versteck entfernt und den Schraubenzieher dabei immer wieder in der Hand dreht. Dann verschwindet er hinter dem Traktor, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ein Stöhnen erfüllt die Luft.
Es kommt nicht von Daddy. Sondern von dem Mann, den er hierhergebracht hat. Wer immer das ist, er stöhnt vor Schmerz. Daddy tut ihm weh.
Dass Daddys Hände, die so groß und stark und schwielig sind und mich so gut umarmen und an den Zöpfen ziehen können, einem Menschen wehtun, ist eine seltsame Vorstellung. »Du sagst mir, was ich wissen will«, wiederholt Daddy. »Freiwillig oder auf die harte Tour. Deine Entscheidung, Ben.«
»Fick dich«, keucht die zweite Stimme – die von Ben.
»Spuck’s aus.«
»Scheiße, ich sag dir gar nichts.« Ein feuchtes Geräusch, irgendwas zwischen Husten und Würgen. Kommt da Spucke hoch oder eher Blut?
»Wie du willst«, sagt Daddy. Verschwommene Schatten strecken sich über den Traktor, ich sehe einen Arm vorschießen, schnell und entschieden. Und dann dieses Geräusch, ein heftiges Aufstöhnen mit zusammengebissenen Zähnen, so grässlich, dass sich mir die Nackenhaare aufstellen. »Der bleibt drin, bis du ausspuckst, was ich wissen will«, sagt Daddy und ich begreife, dass er den Schraubenzieher meint.
Schwarze Punkte tanzen vor meinen Augen. Ich muss mich mit beiden Händen auf dem Boden abstützen. Wenn ich mich nicht zusammenreiße und ganz langsam atme, kippe ich garantiert um. Meine Augäpfel fühlen sich an, als würden sie gleich rausspringen, mein Gesicht ist fest an das raue Brett gepresst. Ich will wegrennen. Aber ich muss hierbleiben und mitkriegen, was passiert.
»Sag’s mir«, wiederholt Daddy.
»Nein.«
Daddy richtet sich auf, ich kann ihn jetzt direkt sehen. Er greift in seine Hosentasche und zieht das Messer mit dem Geweihgriff heraus, das er jeden Sonntag schärft. Lässt die Klinge herausspringen – zwanzig Zentimeter tödlicher Stahl, der im Scheunenlicht aufblitzt – und prüft sie am Daumennagel.
»Dann versuchen wir’s eben anders.«
Daddy kniet sich wieder hin und verschwindet aus meinem Blickfeld, aber ich sehe an dem verschwommenen Schatten seines Arms, wie er ausholt und zustößt. Der Laut, der aus Ben kommt, ist diesmal noch schlimmer, keine zusammengebissenen Zähne, kein Versuch, den Schrei zu unterdrücken. Ich mache die Augen nicht zu, verstecke nicht mein Gesicht, tue nichts von dem, was ich tun sollte. Im Gegenteil, ich reiße die Augen weit auf. Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal überhaupt so genau hinzusehen.
»Sag’s mir«, verlangt Daddy, als Bens Schrei zu einem Wimmern abebbt.
»Geht nicht«, keucht Ben. »Der macht mich kalt.«
»Ihr Springfields, ihr habt echt nicht viel Grips erwischt, was?«, spottet Daddy. »Was meinst du wohl, was ich mache, wenn du mir nicht sagst, wo er ist?«
»Bitte. Ich tue alles – Geld, Huren, Drogen, was immer du willst, Duke, ich …« Ein Aufbrüllen, aber ich kann nicht sehen, was Daddy ihm antut.
Ich presse die Lippen zusammen, um die aufsteigende Übelkeit wegzudrücken, und höre wieder Daddys Stimme: »Sag’s mir.« Er scheint nur noch diese beiden Wörter zu kennen.
»Angggghh«, lallt Ben und ringt um Luft.
»Bitte. Bitte.«
»Sag’s mir.«
»Geht nicht. Carl ist mein Bruder.«
Bens linker Fuß zuckt, wie wenn er sich losreißen wollte. Ich sehe überhaupt nur seine Füße, der Rest ist hinter dem Traktor versteckt, und starre unentwegt seine Stiefel an. Daddy hat die gleichen. Momma hat sie ihm letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Ich hab ihr beim Einpacken geholfen.
»Sag mir, wo Springfield ist«, beharrt Daddy.
»Oder ich schnapp mir Caroline. Was hältst du davon? Ist dir dein Bruder das wert? Hat ziemlich scharf ausgesehen, deine Frau, als ich sie neulich mal zu Gesicht gekriegt hab. Kann sein, ich lass mir Zeit.«
Ich bin zu jung, um zu begreifen, was er damit meint. Später, als ich es dann begreife, bin ich entsetzt. Und rede mir ein, er hätte nur geblufft. Ich will nicht glauben, dass er zu dieser Sorte Mann gehört. Aber vielleicht tut er das doch, die Möglichkeit steht greifbar vor mir.
»Nein«, sagt Ben schwach. »Nicht Caroline. Bitte.«
»Dann sag’s mir«, fordert Daddy. »Wenn du’s tust, lass ich sie in Ruhe und deine Jungs auch. Sie sind in Sicherheit vor mir und meinen Leuten. Ich will bloß Springfield.«
»Scheiße, Scheiße … Carl ist in Manton. Exit 34 am alten Highway. Das Haus hinten am Hell’s Pass. Aber lass verdammt noch mal die Finger von meiner Familie, du Scheißkerl!«
Daddy hebt sich von den Knien und rückt jetzt wieder in mein Blickfeld. »Danke.«
Er bewegt sich blitzschnell, so vertraut ist ihm der Griff. Seine Hände – und die Waffe – scheinen zu verschwimmen. So laut, so furchtbar laut – der Schuss rammt sich regelrecht in meine Ohren, und dann ist da ein irgendwie matschiges Geräusch, bei dem es mir den Magen umdreht. Ich will mir den Mund zuhalten, aber dafür ist es zu spät. Ich übergebe mich, Kotze läuft über mein Shirt, spritzt auf meine Haut. Der Gallegeruch lässt mich noch mehr würgen, und als ich versuche aufzustehen, versagen mir die Beine.
Ich muss ins Haus, bevor er mitkriegt, was ich gesehen habe. Aber meine Beine sind wie aus Gummi, und als ich mir die verklebten Haare aus dem Gesicht schiebe, spüre ich getrocknetes Salz auf meinen Wangen.
Ich will meine Momma so sehr hier haben, dass es wehtut und immer weiter wehtun wird, und allein schon der Gedanke an sie macht mich tapsig und dumm. Als ich mich aufrichte, trete ich gegen einen Stein, der mit einem lauten Knall gegen die Scheunenwand prallt.
Ich erstarre.
»Wer ist da?« Daddys Stimme dröhnt durch die Holzbretter. Seine Schritte bewegen sich rasch über den Boden, dann höre ich das Quietschen des Tors, als er es öffnet und nach draußen schaut.
Oh nein. Mein Magen verkrampft sich wieder. Am liebsten würde ich gleich weiterkotzen.
»Harley, wenn du das bist, hast du genau drei Sekunden, um Bescheid zu sagen. Sonst schieße ich. Eins …«, sagt Daddy.
Meine Gedanken rasen, fieberhaft versuche ich, alles zu begreifen. Daddy hat ihn umgebracht. Und zwar so, als wäre das ganz leicht und hätte nichts weiter zu bedeuten.Als täte er das nicht zum ersten Mal.
»Zwei.«
Was macht er mit der Leiche? Vergräbt er sie? Wo? Im Wald?
»Dr…«
»Ich bin’s!«, schreie ich. Mein Jeans sind verdreckt, mein Shirt ist feucht und voll Kotze. Meine Beine zittern, aber ich stürme trotzdem los, renne bis vor die Scheune.
Er steht am Eingang, Licht strömt heraus, mit einem Arm hält er das Tor immer noch offen.
Hinter ihm in der Scheune ist eine dunkle Blutlache, die schnell größer wird, und daneben das, was übrig ist von Bens Kopf. Sein Gesicht ist zur Seite gedreht, die Augen stehen weit offen, schauen mich an. Er wirkt durcheinander. Als hätte er gedacht, Daddy lässt ihn laufen.
Ich schlucke schwer. Von Nahem ist es noch viel schlimmer. Daddy betrachtet mich, die Neunmillimeter immer noch gezückt. Dann schaut er über seine Schulter auf Ben und die wachsende Blutlache. Er macht einen Schritt zur Seite, damit ich Bens Gesicht nicht mehr sehen kann. »Schätzchen«, setzt er an. »Wie lange …« Er bricht ab. »Liebling«, versucht er noch mal. »Ich …«
Ich starre weiter auf das Blut. Auch wenn ich Daddy schon beim Ausweiden von Jagdwild geholfen habe, so viel Blut habe ich noch nie gesehen. Es ist dunkel und dickflüssig wie Farbe. Aber es riecht ganz anders, scharf wie Kupfer, wie Leben, das im Boden versickert.
»Harley-Girl«, sagt Daddy mit der gleichen sanften Stimme, mit der er mir vor dem Einschlafen Geschichten vorliest. Gleich muss ich wieder brechen. Doch ich beiße die Zähne zusammen und schaffe es diesmal, die aufsteigende Gallensäure runterzuschlucken. Ein wilder Kampf in meiner Kehle, der mir den Schweiß ins Gesicht treibt. Ich schwanke, und dann sind da auf einmal Daddys Hände, sie packen mich um die Taille. Mein Körper wird schlaff, ich wehre mich nicht.
Ich habe zu viel Angst vor dem, was dieser neue – nein, dieser alte, aber bisher verborgene Daddy tun würde, wenn ich es versuche. Er trägt mich zum Haus und die Treppe hoch, ohne ein Wort zu sagen. Er setzt mich auf mein Bett und zieht mir die Stiefel aus; ich zittere vor mich hin und lasse ihn machen. Er tauscht mein vollgekotztes Shirt gegen eins von den Schlafhemden, dann drückt er vorsichtig meine Schulter und ich sinke auf das Bett. Ich sehe Bens leere Augen vor mir und schrecke vor Daddys Berührung zurück, zum ersten Mal in meinem Leben, aber er merkt es nicht. Ich erwarte eigentlich, dass er gleich geht, nachdem er mich zugedeckt hat, aber stattdessen bleibt er lange neben meinem Bett sitzen. Erst als er aufsteht – Stunden später, kommt mir vor –, habe ich den Mut, es auszusprechen. Daddys Umriss zeichnet sich gegen das Licht im Flur ab, er will die Tür gerade zumachen, da platzt es aus mir heraus: »Er hat dir doch gesagt, was du wissen wolltest. Du musstest das nicht tun.«
Ich höre ihn seufzen, kann aber sein Gesicht nicht sehen, weil es im Schatten liegt. Er lehnt sich an den Türrahmen, drückt die Schulter dagegen. »Leben gegen Leben«, sagt er. »Anders geht’s nicht, Harley-Girl.« Leben gegen Leben. Bens Leben gegen das von Momma.
»Du lässt Springfield also laufen?«, frage ich. Daddy streicht sich durchs Haar. »Das kann ich nicht machen«, sagt er.
»Aber …«
»Er hat uns deine Momma genommen«, erinnert mich Daddy sanft. Als ob ich das vergessen könnte. »Aber du hast gesagt, du lässt seine Familie in Ruhe.«
Daddy richtet sich auf. Er wirkt riesig, wie ein Schatten. Sein Gesicht kann ich immer noch nicht sehen, aber was er sagt, höre ich nur zu gut. Drei Wörter, hart wie Schotter: »Das war gelogen.«
Jeden Morgen mache ich meine Runde. Ich nehme ein Gewehr mit, schließlich kann es jederzeit Probleme geben, mit Tieren oder mit Menschen. Alle paar Tage ändere ich die Route. Die kompletten zweihundertfünfzig Hektar kann ich sowieso nicht abdecken. Manchmal tue ich nichts weiter, als am nördlichen Zaun entlang zu patrouillieren, das Segeltuch klatscht mir dabei wie ein unablässiger Herzschlag gegen die Beine. Dukes Jacke ist viel zu groß für mich, aber ich trage sie trotzdem, die Ärmel dreimal umgeschlagen, um die Hände frei zu haben.
An diesem Morgen wandere ich tief in den Wald hinein, mit Busy an meiner Seite. Sie springt schwanzwedelnd vor mir her, ihre gedrungene Nase dicht am Waldboden, wo sie nach Spuren von Rotwild und Pumas sucht.
Ich gehe hinter ihr her, das Knacken von Zweigen und das Knistern der Kiefernnadeln unter meinen Stiefeln mischt sich mit dem heiseren Krächzen erwachender Elstern. Die Luft ist klar und frisch, das Gelände steigt steil an, mein Tritt ist fest und sicher. Jeder einzelne Schritt bringt mich näher, immer bergauf, und meine Sohlen graben sich in die rote Erde.
Was das Land angeht, die dichten Wälder und die Berge aus Vulkangestein, bin ich durch und durch Dukes Tochter. Ich kenne die Gegend so gut wie kein anderer außer Duke, weiß um ihre Gefahren und Geheimnisse. Manches von diesem Wissen werde ich mit ins Grab nehmen – und es spielt keine Rolle, ob bis dahin noch vierzig Jahre vergehen oder vierzig Minuten.
»He!«, rufe ich und schnippe mit den Fingern, wenn Busy zu weit wegläuft, woraufhin sie jedes Mal so abrupt haltmacht, dass sie kurz ins Rutschen gerät. Dann läuft sie den Abhang runter und kommt zurück zu mir. Ihre Augen leuchten im Licht des frühen Morgens, und wenn ich sie hinter den Ohren kraule, legt sie ihren kantigen Kopf genüsslich in den Nacken. »Braves Mädchen«, sage ich. »Weiter.«
Oben angekommen sind meine Stiefel voller Staub und Busy hängt die Zunge aus dem Maul. Als die Steigung abflacht, rast sie begeistert einem Eichhörnchen hinterher und ich lasse ihr den Spaß. Der Stamm der alten Eiche ist mächtig und hat starke Äste auf den unterschiedlichsten Höhen, was sie zu einem perfekten Kletterbaum macht. Aber ich bin nicht zum Klettern hier. Ich nähere mich ihr langsam und bedächtig, so wie ich mich an einen Bock anpirschen würde, den ich erlegen will. Das mag albern sein, aber ich kann nicht anders. Manche Dinge sind heilig. Weit oben auf dem Stamm, schon vor über hundert Jahren eingeritzt, stehen Namen – verwachsen zwar, aber noch lesbar: Franklin + Mary Ellen. Joshua + Abigail. David + Sarah.
Ich fahre mit dem Finger an den Namen entlang nach unten. Es sind über dreißig: die großen Liebespaare des McKenna-Clans, von der Goldrausch-Ära bis heute. Es gab eine Zeit, da habe auch ich davon geträumt, meinen Namen hier einzuritzen. Aber inzwischen bemühe ich mich, nicht mehr an Will zu denken …
River of Violence
Autorin: Tess Sharpe
ISBN: 978 3 423 79045 1
Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv)
www.read-bold.de